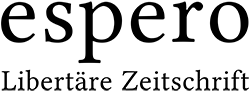Von Bernd Kramer, herausgegeben von Jochen Knoblauch, Berlin: QUIQUEG Verlag, 2024, Paperback, ISBN: 978-3-945874-17-2, 354 Seiten, 22,80 €.
Die Herausgabe des ersten Bandes der Gesammelten Schriften Bernd Kramers ist schon seit Langem überfällig. Dies hat wohl auch mit dem unüberschaubaren schriftlichen Nachlass zu tun, verbunden mit einer teilweise recht unklaren Quellenlage, in der Pseudonyme „geknackt“ und Stilvergleiche angestellt werden müssen, um das Material richtig zuordnen zu können. Der Herausgeber Jochen Knoblauch hatte es wohl nicht gerade leicht!
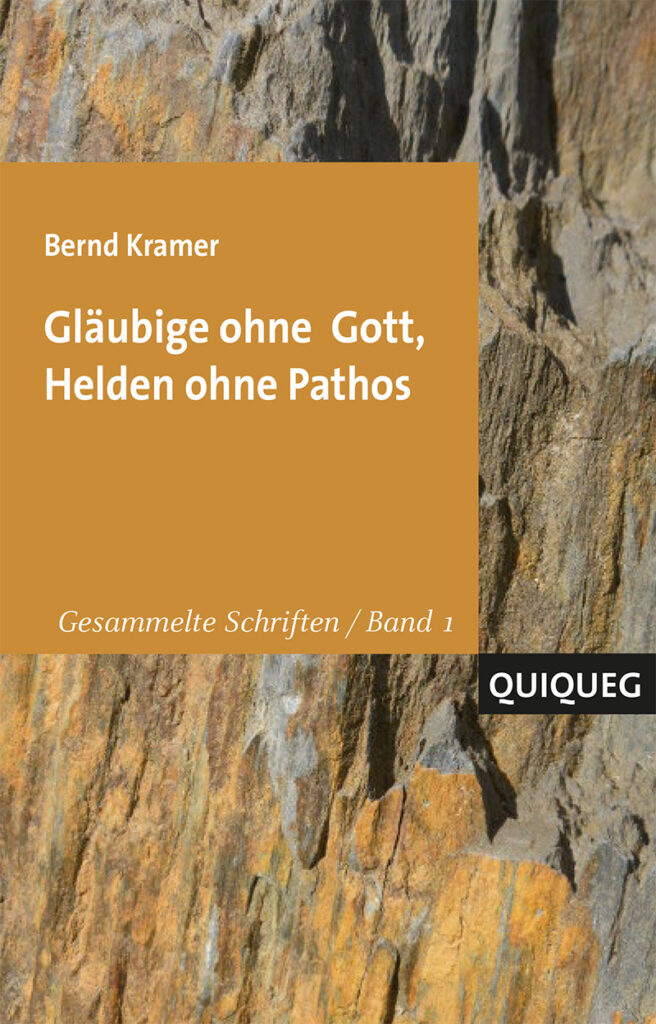
Bernd Kramer war ein Urgestein des Neo-Anarchismus. In Westberlin und darüber hinaus war er ab Mitte der 1960er bis zu seinem Tod (am 5. September 2014) eine prägende libertäre Persönlichkeit. Sein Name ist eng verknüpft mit dem wohl wichtigsten deutschsprachigen anarchistischen Verlag nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Karin Kramer Verlag, den er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Karin entwickelt hat.
Dieser Verlag ist ein Teil der politischen Zeitgeschichte, denn die Renaissance des Anarchismus in der BRD und Berlin/W. im Rahmen der Außerparlamentarischen Opposition setzte ab 1968 gerade auch im publizistischen Bereich ein. Zum ersten Mal seit dem Ende der Weimarer Republik wurden wieder anarchistische Texte einer für diese Themen aufnahmebereiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Zuge der damaligen Kritik junger Antiautoritärer an der Erneuerung des kommunistischen Parteitraditionalismus in Form marxistisch-leninistischer und maoistischer Kaderparteien, lieferte die klassische anarchistische Bolschewismuskritik die richtigen – eben antiautoritären – Antworten darauf. Und gerade der Karin-Kramer-Verlag steuerte die entsprechenden Inhalte mit seinen Veröffentlichungen bei. Stellvertretend dafür steht die Bolschewismus-Kritik Rudolf Rockers und Emma Goldmans: Der Bolschewismus. Verstaatlichung der Revolution (damals noch unter dem Verlagsnamen: Underground Press L).
Neben diesem zentralen Thema rückte die Kontroverse zwischen Marx und Bakunin und die historische Spaltung des sozialistischen Lagers in einen autoritären und antiautoritären Flügel in den Mittelpunkt. Die Neuedition der wichtigsten Schriften Bakunins und Kropotkins durch den Karin-Kramer-Verlag resultierte folgerichtig daraus.
Politisch aktuell Einfluss genommen wurde über die Zeitung Linkeck. Kämpferisches Vokabular, satirischer Stil, chaotisch anmutendes Layout sowie eine politische Ausrichtung am Anarchismus waren die Markenzeichen dieser „Untergrundzeitung“, wie es damals hieß. Ab 1967 erschienen die ersten Nummern des von Bernd und Karin herausgegebenen „ersten antiautoritären“ Blattes, das immerhin Auflagehöhen zwischen 4.000 und 8.500 Exemplaren erreichte.
Der vorliegende Buch-Titel Gläubige ohne Gott, Helden ohne Pathos sagt wohl auch einiges über die Persönlichkeiten der Kramers aus. Im Zuge ihres unermüdlichen Engagements für den Verlag und in der libertären Bewegung sahen sie sich jahrzehntelang herausgefordert, den „Rund-um-die-Uhr-Job“ als Autor:in, Verleger:in, und nicht zuletzt als Eltern, wirtschaftlich stets im Würgegriff des Existenzminimums zu führen. Dies hinderte einzelne Szene-Menschen nicht daran, sie als „Profitmacher“ anzuprangern, die sich mit den „zu teuren“ Büchern individuell bereichern würden. Diese unfairen Angriffe und Übergriffe mussten oft abgewehrt und vieles, soweit möglich, ertragen werden.
Bernd Kramer war ausgebildeter Schriftsetzer, aber als Verleger ein Autodidakt. Man spürte bei ihm noch die Freude des bildungshungrigen Arbeiters an der Erkenntnis. Jenseits der Zwänge eines akademisch geprägten Wissenschaftsbetriebs konnte er an den aktuellen Debatten der antiautoritären Szene teilnehmen, Themen aufgreifen und ohne Scheu vor intellektuellen Autoritäten eigene Statements artikulieren. Diese wurden wiederum in Form von Vor- und Nachworten in die Verlagserscheinungen eingeflochten.
Bernd Kramer hatte ein instinktives Gespür für Themen, die in der Luft lagen. Zugleich war er auch enorm belesen, und man spürte, dass er Sachverhalte auch theoretisch durchdrungen hat. Als Mensch war er ein Vollblut-Anarchist vom Schlage eines Michael Bakunin. Manchmal sah man ihn auf Polit-Veranstaltungen und Buchmessen, samt Calvadosflasche in der Jackentasche und Zigarrenstummel im Mund, herumschlendern, um Auslagen zu begutachten, Leute zu begrüßen und mit ihnen zu diskutieren. Im Gespräch fiel seine Gabe der assoziativen Kreativität auf, die blitzschnell Zusammenhänge sichtbar machen konnte und begrifflich auf den Punkt brachte. Bis ins hohe Alter blieb er stets neugierig und ging recht unkonventionell an die Dinge heran. Auch schien eine gewisse Widersprüchlichkeit Ausweis seiner Authentizität zu sein. Political Correctness war seine Sache nicht. Eher war er Freigeist und Ketzer − auch als Anarchist − Genoss:innen gegenüber.
Und nun zu Bernd Kramers Gesammelten Schriften, Band I. Beim ersten Sichten der Beiträge gerät man in eine Art Zeitmaschine. Es kommt einem vor, als sei alles erst gestern passiert. Das Buch ist anregend und interessant illustriert und man bekommt sofort Lust zum Lesen, natürlich auch, weil die damalige spannende Zeit innerlich wieder aufblitzt. Man glaubt, den Optimismus und die Zukunftsfreude dieser Zeit zu spüren, im Kontrast zum aktuell grassierenden Pessimismus. Das Buch kann ebenso auch als ein Archiv des Neoanarchismus angesehen werden. Neoanarchismus − verstanden als der undogmatische Flügel der Außerparlamentarischen Opposition im Zuge der antiautoritären Jugendrevolte. Darin verbanden sich klassische Strömungen des Anarchismus und marxistische Analysen mit aktuellen Erkenntnissen der Psychoanalyse. Neue Lebensentwürfe und gesellschaftliche Utopien wurden aufgegriffen und alltagspraktisch erprobt.
Das Buch bietet vor allem auch die Gelegenheit, sich, mit dem Abstand von heute, noch einmal mit Tendenzen, Irrtümern, und der Theorierezeption von damals auseinander zu setzen. Und dies mit gutem Grund. Denn es verdeutlicht sich auch die fortdauernde Aktualität der Kritik des anarchistischen Antiautoritarismus als Korrektiv und Messlatte gegenüber autoritären Tendenzen heute, denkt man z. B. an Solidarität mit Putin-Russland im Krieg gegen die Ukraine und mit der islamfaschistischen Hamas im linken, linksradikalen und bis ins anarchistische Lager hinein.
Das Buch ist nicht nur als eine Bestandsaufnahme des Verlagsprogramms angelegt, sondern ermöglicht auch, mit Hilfe ausgewählter Veröffentlichungen, die Bewegungsgeschichte und die theoretische Entwicklung des Neoanarchismus nachzuvollziehen. Die Gliederung erfolgt anhand übergeordneter inhaltlicher Schwerpunkte des Verlagsprogramms, wie z. B. Geschichte des Verlages (erster, zweiter und dritter Teil), weiter unterteilt in Kapitel zum Verhältnis von Anarchismus und Utopie und zu anarchistischen Persönlichkeiten, wie Michail Bakunin, Louise Michel, Max Hoelz und anderen, die als Autor:innen mit ihren Buchtiteln im Programm vertreten waren. Diese Kapitel sind in sich chronologisch geordnet. Die politische Entwicklung des Verlegers kann in seinen Kommentaren, Vor- und Nachworten parallel dazu herausgelesen werden.
Gleich am Anfang steht ein Buch über das Leben des Vaters Gustav Kramer: Widerstand und Kunst, der authentischer Weise als widersprüchliche Persönlichkeit dargestellt wird, die sich von früheren Irrtümern gelöst hat (zunächst SA-Mitglied), sich aber in Richtung Antifa weiterentwickelt hat.
Geschichte des Verlages (Erster Teil):
Im Jahr 1973 erscheint das Buch von F. Amilé (Pseudonym von Bernd Kramer), H. D. Bahr, A. Krésic und R. Rocker: Marxismus und Anarchismus. Es beinhaltet repräsentativ die Auseinandersetzungen mit dem autoritären Marxismus und die Debatte über den richtigen – freiheitlichen – Weg. Einleitung, Begleit-, Vor- und Nachwort sind von Bernd Kramer.
Anarchismus und Utopie
Im Verlagsprogramm erscheint schon früh die Thematik Utopien als Buchreihe. Es geht dabei um die Wechselbeziehung von Anarchismus und Utopie, und wie Realsozialismus und Leninismus usw. dem gegenüberstehen. Im Vor-, Nach- und Begleitwort zu Giovanni Rossi: Utopie und Experiment appelliert Bernd Kramer dafür, das „Unmögliche“ an der Utopie, zu diskutieren und zu verarbeiten. Eine Trennung von politischer und literarischer Utopie, also von Inhalt und Form, lehnt er ab. Ein sofortiges und tägliches „Neues Beginnen“ sei ohne Voraussetzung möglich. Als Referenz zieht er den „sozialen Anarchisten“ Gustav Landauer sowie den Neo-Marxisten Herbert Marcuse und die Psychoanalyse heran.
Im Buch Reise nach Utopia zitiert Bernd Kramer seine Tante mit einem Ausspruch im Sinne von Ernst Bloch: „Was nicht ist, kann noch werden!“ und gelangt damit zur möglichen Realisierung des Utopischen und damit zum „Ende der Utopie“. Und in der Einleitung zu Ludwig Holberg: Niels Klims unterirdische Reisen interpretiert Bernd Kramer die im Buch angesprochenen und sämtliche Utopien als „angriffslustige Revolten, die das Bestehende umgehen.“ Der Kommentar macht ernsthaft Lust, das Buch einmal (wieder) zu lesen!
Der als Autor des Buches Der Rebell Anarchik! genannte Robert Halbach ist Bernd Kramer daselbst. Darin geht es um die politische und revolutionäre Farbenlehre und Symbolik, wie beispielsweise das Anarcho-Männchen und die schwarze Fahne.1
In Jörg Asseyer, B. Kramer, H. J. Viesel und H. D. Heilmann: Hiebe unter die Haut geht es um die Interpretationen marxistischer Bakuninrezeptionen, um Anarchismusdefinitionen sowie um die Propaganda der Tat. Darin kritisiert Bernd Kramer konkret den Autor Kurt Lenk und dessen Kritik an der theoretischen Einschätzung des Staats- und Gesellschaftsbegriffs Bakunins.
Die erste Auflage von Michael Bakunin / Sergej Necajev: Gewalt für den Körper, Verrat für die Seele? erschien 1980. Die zweite Auflage war das letzte Buch im Karin-Kramer-Verlag und ist im Jahr 2014 erschienen. Darin wird eine Debatte über einen Revolutionären Katechismus geführt, also über das Für und Wider revolutionärer Gewalt und die „Zweck-Mittel-Relation“ derselben. Es werden auch Parallelen zu den „Befreiungskämpfen heute“ gezogen. Herausgearbeitet wird interessanterweise, dass „die Früheren“ eher Hemmungen hatten, Unschuldige und Kollateralschäden einzukalkulieren. Eine Annahme, die im Jahr 2024 sehr aktuell klingt. Eine Ausnahme würde jedoch Netschajew bilden, der, aufgrund seiner Herkunft aus der Leibeigenschaft, extrem hassgesteuert war.
In Worte an die Jugend. Prinzipien der Revolution von Sergej Netchajew und Michail Bakunin: Einige Worte an die jungen Brüder in Russland aus dem Jahr 1984 äußert sich Bernd Kramer anonym zum Parlamentarismus der Grünen und ihrem Hang zur Regierungsbeteiligung, persönlich kritisiert er besonders Daniel Cohn-Bendit.
Bakunin
Im Nachwort zu der von Wolfgang Eckhardt erstellten Bakunin-Bibliografie2 erörtert Bernd Kramer die Wechselbeziehungen des Gegensatzpaars Ordnung und Chaos. Das Buch Bakunin – Ein Denkmal? Kunst – Anarchismus entstand in Zusammenarbeit mit der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst e. V. im Jahr 1996. Darin wird die Idee zu einem Bakunin-Denkmal in die Welt gesetzt und mit einem Aufruf zur Kooperation verbunden. Vieles dazu ist schon im Jahr 1988 in der Kreuzberger Kneipe „Zum goldenen Hahn“ entstanden. Dann geriet der Mauerfall dazwischen, sodass das Buch erst im Jahr 1996 erschienen ist, jedoch mit inzwischen eingegangenen Anmerkungen und Entwürfen dazu. Ein Tagungsband Bakunin 1849 in Dresden aus dem Jahr 2000 erörtert unter anderem Bakunins Idee, Raffaels Bild „Sixtinische Madonna“ auf den Mauern des revolutionären Dresdens gegen die belagernden Preußen zu präsentieren, um sie zu provozieren.
Bernd Kramer und Wolfgang Eckhardt veröffentlichten im Jahr 2008 den Bakunin-Almanach, Bd. 1. Darin zitiert Bernd Kramer, wie Michael Bakunin im Frühjahr 1849 in der Leipziger Gaststätte „Zum goldenen Hahn“ russischen Punsch ausschenkt. Laut Vorbemerkung stellten Kapielski und Kramer im Jahr 1997 bei der UNESCO den Antrag, die Berliner Gaststätte „Zum goldenen Hahn“ in die Liste der Weltkulturerbestätten aufzunehmen. Bei Recherchen zum Buch fand Bernd heraus, dass es in Leipzig auch einen Gasthof „Zum goldenen Hahn“ gegeben hatte, in dem Bakunin Stammgast war. Auch eine Situationsbeschreibung samt Gesprächsprotokoll fand er im Archiv.
Anmerkungen
1 Siehe auch: Weshalb schwingen Anarchisten ein schwarzes Tuch?, in espero, Nr. 52, 2007.
2Wolfgang Eckhardt: Michail A. Bakunin (1814-1876). Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur in deutscher Sprache., Nachwort von Bernd Kramer, herausgegeben von Jochen Schmück, Berlin: 1990 (= Archiv für Sozial- und Kulturgeschichte; 4).
Rolf Raasch
Quelle: espero Nr. 9/10, Dezember 2024, S. 495-505.